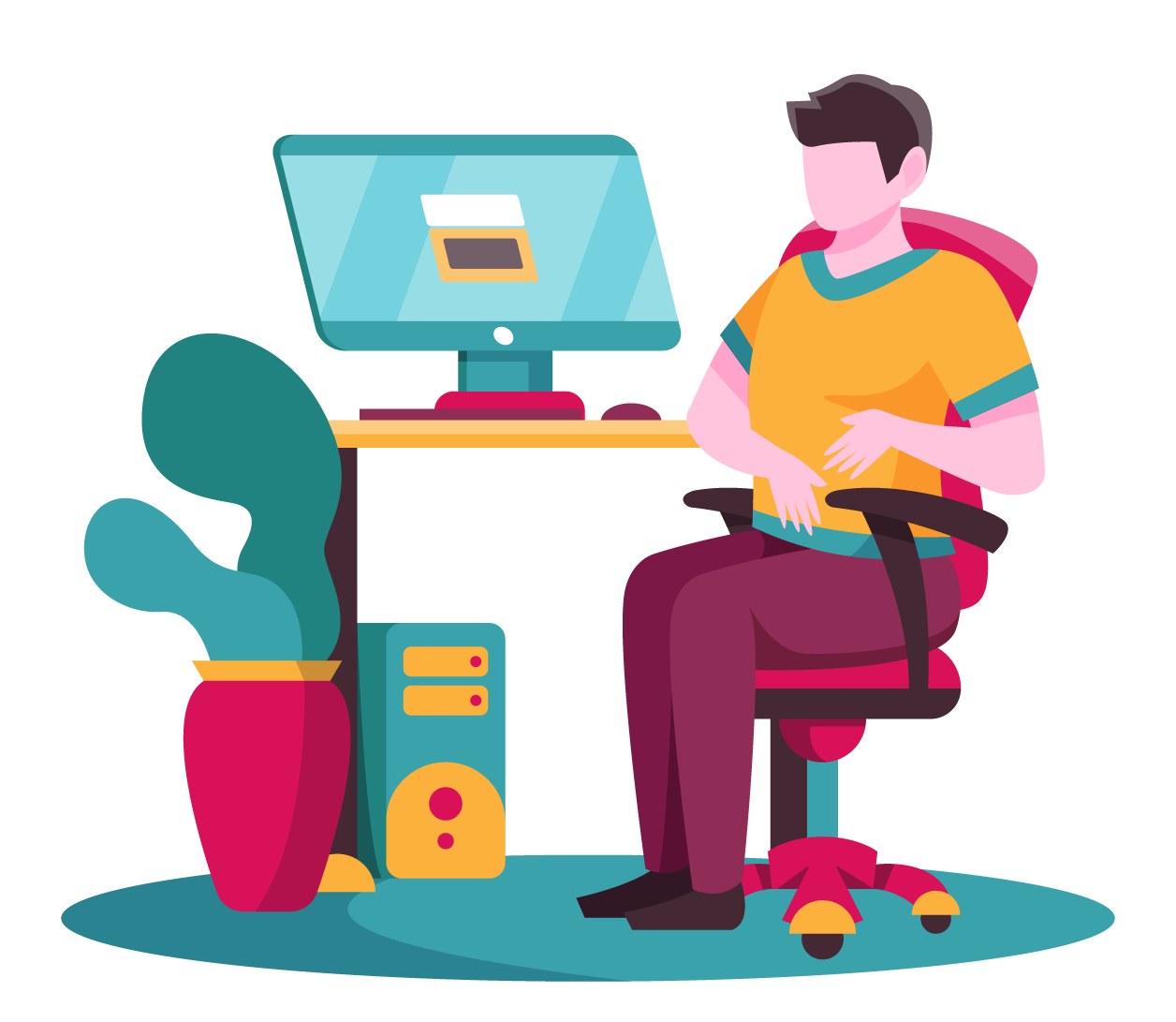Emotionale Abgrenzung Part II
Weiterführung zum Beitrag Emotionale Abgrenzung. Du solltest unbedingt den ersten Teil lesen, bevor Du hier weiterliest. Den findest Du hier.
In diesem Beitrag geht es darum, dass ich Dir erläutere, welche Rolle emotionale Abgrenzung für das Erwachsensein hat.
Viele meiner Patienten sind emotional nicht von ihren Eltern oder Bezugspersonen abgegrenzt.
Wofür soll das wichtig sein?
Wir sind von unserer Erziehung und der damit verbundenen Zuwendung unserer Eltern geprägt worden. In der Lebensphase des Kleinkindalters wollten wir dabei ganz besonders unseren Eltern gefallen. Wenn unsere Eltern etwas gut fanden, fanden wie das auch gut; wenn unsere Eltern etwas schlecht fanden, dann fanden wir das auch schlecht.
Je mehr Zuneigung uns dabei gegeben wurde, umso sicherer fühlten wir uns. Wir konnten ganz klar unterscheiden, was „gut“ also erstrebenswert und was „schlecht“ also zu vermeiden ist.
Nun ist es so, dass uns, als wir in die Zeit der Adoleszenz (Pubertät) kamen, uns die Meinung unserer Eltern immer weniger interessierte. Wir wurden selbstständiger und machten unsere eigenen Erfahrungen.
Wenn Eltern jedoch nicht genug Sicherheit vermittelten, weil sie nicht genug Raum geben eigenen Erfahrungen zu sammeln, oder, weil Dinge unklar waren (…was gut und schlecht ist wechselte je nach Laune) dann bleibt häufig ein unbewusstes Gefühl der Unsicherheit zurück. Kinder dieser Eltern reagieren dann häufig mit ständiger Rückversicherung („…mach ich das auch gerade richtig“) oder dem Gegenteil, mit Rebellion („…wenn ihr das gut findet, dann mach ich es extra anders“) und das bis in das Erwachsenenalter. Häufig verstärken Eltern unbewusst diese Reaktionsmuster.
Beide Reaktionsformen sind jedoch abhängig von den Eltern und somit ungünstig um erwachsen zu werden.
Im nächsten Beitrag werde ich auf dieses Thema weiter eingehen.
Falls Du Fragen diesbezüglich hast: Schreib mir gern!
Gregor Röpnack